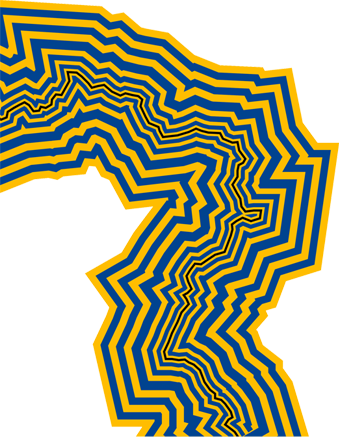Elisabeth Sacharov
Elisabeth Sacharovs Essay ‚Durch die einsamen Steppen des Niemandslands‘ entführt Sie in die vergessene Siedlung Ossakarowka in Kasachstan, wo sie die Schatten der Repressionen und Zwangsarbeit aufdeckt, die Generationen ihrer Familie geprägt haben.
Elisabeth Sacharow beschreibt in ihrem Text eine Reiseerfahrung, die Erinnerungen an den kasachischen Ort Osakarowka weckt. Einst ein Zentrum für Deportierte während der Sowjetzeit, verbindet die einstige Sondersiedlung in der kasachischen Steppe für die Autorin, die selbst zur Nachfolgegeneration der Zeitzeugen gehört persönliche Familiengeschichten mit der schmerzlichen Vergangenheit der kollektiven Repressionen. Der Text reflektiert über Heimat, Verlust und die Bedeutung von Erinnerung, während die Autorin über das ambivalente Gefühl der Rückkehr in die Geschichte ihrer Vorfahren nachdenkt.
Durch die einsamen Steppen des Niemandslands
Es ist 13 Uhr mittags. Die riesigen Glasscheiben reflektieren die schwache Frühlingssonne, sodass man davon beinahe geblendet wird. Doch mir fallen trotzdem die Augen zu. Unser Flug, der sieben Stunden dauerte, ist vorbei und nun heißt es – erstmal abwarten.
Ich werde diesen Tag und dieses ambivalente Gefühl wahrscheinlich nie vergessen. Man fühlt alles und nichts zugleich: Man ist erschöpft und gleichzeitig energievoll, fröhlich und betrübt, verängstigt, aber auch gelassen.
Es ist wie eine Trance. Die Gespräche um mich herum, rollende Koffer auf dem Fliesenboden, Durchsagen über den Lautsprecher – alles vermischt sich. Und trotzdem, aus irgendeinem mir unerklärlichen Grund, kriege ich jedes Wort von dem Gespräch der zwei Männer neben mir mit. Sie verließen, genauso wie 25 andere Familien, an diesem Tag ihr Herkunftsland, um ein neues Leben in Deutschland aufzubauen. Sie reden über ihre Jobs – beide sind Handwerker – über das Essen im Flugzeug und über ein Dorf.
Und als ich den Namen dieses Ortes höre, werde ich hellwach.
Osakarowka. Ein Ort mitten im Nirgendwo. Heutzutage – fast ausgestorben. Doch früher war die Siedlung voller Leben. Anfang des 20. Jahrhunderts gründeten Landleute des russischen Reichs diese Siedlung. Sie organisierten ihr Alltagsleben, bauten kleine Häuser aus Lehmziegeln und Brunnen.
Doch das Leben bei den widrigen klimatischen Verhältnissen war hart. In den 30er Jahren blieben etwa 150 Bewohnerinnen und Bewohner, die meisten gaben ihren neuen Wohnort auf. Ein Traum von einem neuen Leben zerbrach an der Realität.
Hiermit könnte die Geschichte der Siedlung beendet sein. Denn an diesem Ort ging es nicht ums Leben, sondern ums Überleben. Im Winter ist es hier bitterkalt, im Sommer brühend heiß. Der Ackerbau ist fast unmöglich, die Tierhaltung auch. Das Wasser ist ebenfalls knapp. Es ist nicht verwunderlich, dass die Menschen sich darauf nicht einlassen wollten. Doch dieses Glück hatten nicht alle. Nicht alle konnten diesen leblosen Ort freiwillig verlassen.
In den 1930er – 1940er Jahren wurden tausende Menschen aus der ganzen Sowjetunion unter anderem in diese Region verbannt. Die sogenannte „Kulaken“ – wohlhabende Bauern und Handwerker, politische Gegner, Pfarrer, ethnische Minderheiten – Deutsche, Koreaner, Tschetschenen, Inguschen, Griechen. Sie galten als Klassenfeinde, Spione, potenzielle Heimatsverräter und mussten daher Zwangsarbeit leisten. Viele von ihnen starben tagtäglich. Und auch nach ihrem Tod wurden diese Menschen nicht besser behandelt. Sie wurden wie Tiere in den Massengräben gleichgültig begraben und mit dem Erdboden gleichgemacht.
Und noch heute, wenn man durch die Steppenstraßen da unten fährt, sind viele kleine Erdhügel erkennbar. Und man kann sich ziemlich sicher sein, dass unter der Erde Mütter, Ehemänner oder Kinder von irgendwem liegen. Hunderte von unschuldigen Menschen, die definitiv keine Verbrecher waren.
Ich war auch einige Male mit meinem Opa in Osakarowka. Sein Vater war einer von den Deportierten. In den Ferien besuchten wir manchmal diesen Erinnerungsort. Mein Opa zeigte uns sein altes Haus, einen kleinen Teich, an dem mein Uropa mit meiner Mutter damals angelte. Wir besuchten unsere Verwandten und seine alten Freunde. Wir Großstadtkinder bewunderten freilaufende Hühner und Schweine in den staubigen Straßen, pflückten Himbeeren und Blumen. Wir hatten viel Spaß zusammen, lachten viel, vor allem als mein Opa Geschichten über seine Jugend und Kindheit erzählte. Er wirkte aber auch manchmal nachdenklich, wenn er in die weite Ferne, in die endlose Steppe schaute und tief Luft, die nach Wermut roch, holte.
Osakarowka war für uns auch ein Zwischenstopp, wenn wir nach Astana, in die Hauptstadt von Kasachstan fuhren. Der Ort liegt nämlich genau in der Mitte der Autobahnstrecke zwischen Karaganda und Astana. Während meine Mutter ein paar Snacks und was zum Trinken an der Busstation kaufte, unterhielt sich Opa mit Menschen, die ihm entgegenkamen. Aus diesen Gesprächen kam fast immer heraus, dass es wohl gemeinsame Bekannte gab. Und gemeinsame Bekannte aus Osakarowka, konnte mein Opa fast bei jeder seiner Begegnung finden. Egal wo. Mein Bruder und ich verdrehten dabei oft die Augen. Es kann doch nicht sein, dass so viele diese winzige Siedlung kannten. Oft nahmen wir diese Gespräche einfach nicht ernst. Vielleicht waren Menschen einfach nett zum Opa und haben sich daher bloß etwas ausgedacht.
Die Männer lachten. Als ich meinen Bruder anguckte, schmunzelte er und meinte, dass unser Opa vielleicht doch nicht ganz Unrecht hatte. Es gibt tatsächlich eine Menge Menschen, deren Schicksale für immer mit diesem Ort verbunden sind. Schade, dass er jetzt nicht dabei sein kann. Er könnte sich sicherlich ins Gespräch einbringen. Meinen Bruder und mich bringt dieses Gespräch jedenfalls zum Nachdenken. So saßen wir beide. Und schweiften in unseren Gedanken. An die Pferde, die schnell wie der Steppenwind sind, an den Geschmack der Tschebureki von der Busstation, an den klaren, wolkenlosen Himmel. An den Opa, an das Dorf und daran, dass man manchmal tiefer blicken muss, um die Wahrheit zu ergründen.