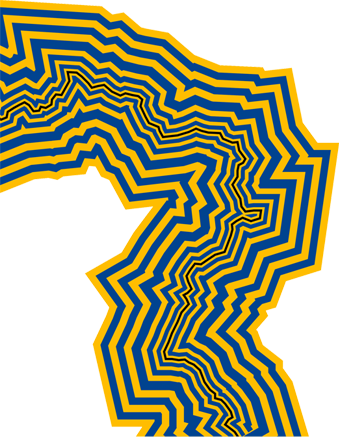Was bleibt einem auch übrig, außer Durchhalten.
In Zeiten wachsender negativer Stimmen zu Zuwanderung und Flucht, sind positive Stimmen der gelungenen Integration rar. Verständlich, wenn es für die haupt- oder ehrenamtliche Arbeit vor Ort vorne und hinten nicht reicht. Woher die Zeit nehmen davon zu berichten. Dieser Text möchte exemplarisch einen positiven Blick auf die ehrenamtliche Arbeit im Rahmen der Flüchtlingshilfe für Menschen aus der Ukraine richten und gleichzeitig auf die bestehenden Ungerechtigkeiten und Grenzen aufmerksam machen.
Ganz beseelt kam ich aus der Frühjahrsakademie der Deutschen Gesellschaft e.V. und der Akademie am Tönsberg zum Thema „Junge Russlanddeutsche und der Ukrainekrieg“ im April 2023 heim. Im Gepäck die Idee über meine persönlichen Erfahrungen der ehrenamtlichen Arbeit in der Flüchtlingshilfe vor Ort zu berichten und gleichzeitig einen Bogen zu spannen, rüber zum eigenen Ankommen in Deutschland vor 30 Jahren. Voller Elan wollte ich über meinen Einstieg in dieses Ehrenamt berichten. Wie mich diese Arbeit meiner Muttersprache Russisch wieder näher brachte und wie ich die noch nach über 30 Jahren tiefsitzende Scham und Zurückhaltung ein Stückchen mehr abstreifen konnte. Wie sehr ich den Mut, die Willensstärke und Ausdauer meiner Eltern stärker begreifen konnte, die mit 2 Kindern und 2 Holzkisten vollgestopft mit eigens dafür neu angeschafften Haushaltsgegenständen und ohne Deutschkenntnisse 1991 aus Kasachstan in die für sie fremde Heimat der Vorfahren ausreisten. Welche Parallelen ich in der Ankunft der ukrainischen Menschen in Deutschland und unserer eigenen sah.
Wenn ich das alles hier kurz anreiße, kribbeln mir wieder die Finger, um endlich anzufangen. Nur leider hindert mich eklatant wichtiges daran: ZEIT! Und die ständige Not, die ich mit ihr habe.
Zeit mir über die richtigen Worte Gedanken zu machen und diese auch niederzuschreiben. Denn wie viele andere auch, muss ich meine Zeit gut einteilen. Lohnarbeit, Familie, meine lokalen Ehrenämter und Engagements und seit März 2022 meine Tätigkeit für ukrainische Familien. Mittlerweile sind es 8 Familien, von alleinstehend, kriegsbedingt alleinerziehend bis 5 köpfige Familie begleite ich diese Menschen in Alltagsfragen und helfe dabei vor allem in bürokratischen Dingen. Die Fragen dieser Menschen und meine Tätigkeit verändert sich seitdem stetig. Heute gilt es nicht das Ankommen der Ukrainer (Einwohnermeldeamt, Ausländerbehörde, Sozialamt/Jobcenter, Kita/Schule) zu organisieren und mitzubegleiten. Viel mehr sind es alltägliche Fragen und Situationen, die für jede Familie, ja jeden einzelnen dieser Menschen, höchst individuell sind und die Lösungen komplex und nicht selten zeitraubend macht.
Und auch hier fehlt mir im Alltag die Zeit für meine Ukrainer. Ständig muss ich alles und jeden in meine ohnehin schon vollen Tage und Wochen unterbringen. Gerne würde ich öfter einfach länger zum Tee bleiben, damit wir nicht nur den Behördenkram klären und abarbeiten können, sondern auch alltägliche Themen Raum hätten. Einfach über die verflixte deutsche Grammatik kopfrauchen, die im deutschen Alltag kaum einen interessiert. Begrifflichkeiten, Zweideutigkeiten und Witze verstehen, darüber lachen oder einfach vom heutigen Alltag berichten. Zeit zum Zuhören, wenn die Menschen über den andauernden Krieg im eigenen Land, die täglichen Katastrophennachrichten, die Sorge um Familie und Freunde in der Ukraine und überhaupt, die Sinnhaftigkeit von allem reden möchten. Alles im Hasengalopp. Und nie wirklich voll da, weil schon der nächste Termin drückt oder die nächste Aufgabe zu stemmen ist.

Warum ich trotz andauernder Zeitnot weiter helfe? Weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt in den ersten Tagen, Monaten und auch Jahren fremd und verloren zu sein. Wie man sich allein durchwurschtelt. Sich permanent Hilfe suchen muss, damit man ein Sprachrohr schriftlich und mündlich besitzt. Eine Aufgabenbewältigung auf wackeligen Füßen, immer mit der Angst im Nacken etwas falsch zu machen, sich nicht genug angestrengt zu haben oder sogar negativ aufzufallen.
Meine Entscheidung flüchtenden Menschen aus der Ukraine zu helfen habe ich bewusst getroffen. Schließlich habe ich mich in 30 Jahren erfolgreich in Deutschland integriert oder besser gesagt vorbildlich assimiliert. Auch mit meinen mittlerweile dürftigen und bewusst verdrängten russischen Sprachkenntnissen könnte ich den Menschen beim Ankommen helfen, so mein damaliger Gedanke. Diese Einschätzung war richtig und hat sich bis heute nicht geändert. Außer mein Russisch, das kommt mir nun einfacher über die Lippen.
Was mir bei meinen Begegnungen als Mittlerin für die ukrainischen Menschen auffällt ist, wie hilfsbereit und freundlich man uns in Behörden und anderen Institutionen begegnet, wenn ich dabei bin oder die Kommunikation im Auftrag der Menschen übernehme. Das ist für mich persönlich nicht sonderlich überraschend, arbeite ich ja selbst auf dem „Amt“ und kenne die Strukturen und Menschen dahinter. Ich merke aber welch enormen Einfluss die Verständigung in deutscher Sprache und das Wissen um die „deutschen“ Umgangsformen auf die jeweilige Situationen haben. Meistens negative, wenn die Menschen die erwarteten Vorstellungen nicht oder nur spärlich erfüllen. Die Sprachlosigkeit und Verlorenheit werden den in Deutschland fremden Menschen vorgehalten, anstatt diesen behilflich zu sein. Termine und Vorsprachen werden sofort verwehrt oder zumindest erschwert, wenn man nicht wie selbstverständlich eine eigene Übersetzer*in mitbringt. Die Kommunikation im komplizierten Ämterdeutsch und die Formularlawine, die auf die Menschen einprasselt, verunsichert die auf Hilfe angewiesenen Menschen auf der einen Seite und entrüstet die Sachbearbeitenden auf der anderen. In einem Land, in dem das Wort „Amt“ oder „Antrag“ Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte im gleichen Maße zusammenzucken lässt, hat man hauptsächlich Unverständnis oder Genervtheit übrig für die vermeintlichen „Fehltritte“ der ausländischen Menschen.
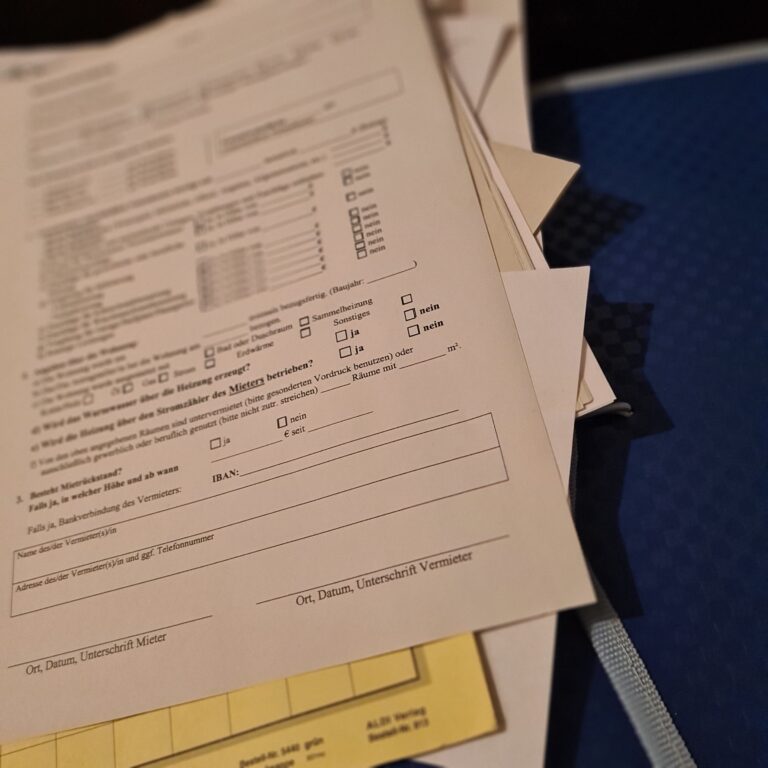
Dieses Bürokratiekarussel ist für die Betroffenen, neben vielleicht teilweise örtlich geschaffenen Strukturen und engagierten Sachbearbeitenden, hauptsächlich fast nur durch massiven Einsatz und das Engagement von Ehrenamtlern zu bezwingen. Dies ist nur leider keine Selbstverständlichkeit und örtlich höchst individuell. Wer soll denn da durchblicken? Das schaffen sogar gestandene Hiesige nicht.
Im selben Atemzug wird das Zauberwort gezückt „INTEGRATION“! In Deutschland eher verstanden als Assimilation, wenn man die immerwährende und vor allem aktuell unerträgliche Diskussion verfolgt. Denn so vermeintlich einfach das für manch einen Nichtbetroffenen klingt, ist es für die ausländischen Menschen mit harter Arbeit verbunden. Teils monatelanges Warten auf einen Sprachkurs, der dann im Schweinsgalopp durchgepaukt und hoffentlich nicht nur mit einem Qualifizierungszertifikat bestanden wird, sondern die Menschen auch tatsächlich zum alltäglichen Sprachgebrauch befähigt. Das Überwinden der Sprachlosigkeit wiederum ermöglicht endlich die Aufnahme einer Beschäftigung. Einer Beschäftigung, der man in seinem Heimatland bis zuletzt nachging und über entsprechende Qualifikationen verfügt kann man aber erst nachgehen, wenn das formale und langwierige Verfahren zur Anerkennung der ukrainischen Abschlüsse positiv entschieden wird. Dann bleibt weiterhin zu hoffen, dass man im erlernten Beruf in Deutschland Fuß fassen kann. Hilfestellung ist dabei im Übrigen genauso eklatant wichtig. Woher sollen die Menschen im Detail wissen, welche formalen Hürden das Bewerbungsverfahren in Deutschland zum Teil für einen bereit hält. Das ist sogar für viele Deutsche ein Kraftakt. Bis dahin werden durch das hiesige Jobcenter bestenfalls berufsnahe Stellen vermittelt. Den schnelleren Erfolg hat man jedoch im Mindestlohnsektor oder bei Zeitarbeitsfirmen. Auch hierüber sind die Menschen froh. Endlich einer Beschäftigung nachgehen. Nicht mehr diese ewige Warterei ertragen. Der Arbeitsalltag, oft mit anderen Migrant*innen, trägt bei diesen Aushilfsjobs allerdings kaum dazu bei, das erlernte Deutsch zu festigen und durch das Sprechen im Alltag zu verbessern. Denn im hektischen Arbeitstag muss das geforderte Pensum abgeliefert werden, da bleibt keine Zeit ordentlichen Satzbau zu betreiben. Da beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz (Diese Redewendung werde ich meinen Ukrainern noch erläutern müssen). Steigen die Menschen schnellstmöglich ins Berufsleben ein, vernachlässigen dabei die deutsche Sprache, weht ihnen der gleiche abwertende Wind entgegen, wie bei der Ausschöpfung aller in Deutschland möglichen Förderquellen zum Erlernen der deutschen Sprache, um damit einen qualifizierteren Einstieg ins deutsche Berufsleben zu erleichtern. Dass sich die Menschen in familiäre und kulturelle Kreise zurückziehen, sollte also eigentlich keinen wundern. Ganz nach dem Motto: „Wenigstens mache ich hier nichts falsch und werde als vollwertiger Mensch behandelt.“
Das alles kenne ich übrigens viel zu gut. Nur habe ich vor 30 Jahren, als damals 10jährige mit massivem Assimilationswillen und tollen mich immer unterstützenden Lehrkräften, diese Erfahrungen nicht oder nur selten gemacht. Ich konnte mein Berufsleben nach dem regulären Abschluss meiner Schullaufbahn als Vorzeige-Russlanddeutsche, ohne Akzent und einem neutralen Namen, starten und bis heute problemlos fortführen. Meine Eltern dagegen, hatten sich damals bewusst für ein Ankommen im deutschen Dorfleben und gegen die Sicherheit von Ballungsgebieten entschieden. Sie hatten es umso schwerer im Berufsleben und im deutschen Alltag anzukommen. Es hat sich seitdem nicht allzuviel geändert. Auch der zum Teil raue Ton, die Verallgemeinerungen und belächelnden bis abschätzigen Blicke auf vermeintliche kulturelle Sonderheiten sind heute weiterhin präsent. Egal wie stark man versucht sich zum tausendsten Mal zu erklären. Der aufgedrückte Stempel bleibt.
Kommen wir zum eigentlichen Kern und zu meinem größten Problem. Die liebe Zeit und das Ehrenamt. Dieses Dilemma betrifft an sich alle, die sich ehrenamtlich engagieren. Es braucht dazu auch keine ehrenamtliche Arbeit, um Zeitnöte zu haben. Unser aller Alltag schafft das auch ganz allein. Allerdings ist das absolute Wesensmerkmal des Ehrenamts das soziale Miteinander zu erhalten, zu fördern und auszubauen. Dafür braucht man Zeit. Zeit für die Arbeit miteinander, Zeit für´s Gespräch: Zeit, Zeit, Zeit! Das vordergründlichste Problem im Bereich der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit und warum es über kurz oder lang dringend einer Verbesserung der Situation für alle bedarf, ist die Tatsache, dass dieses Ehrenamt mehr und mehr die Aufgaben unseres Sozialstaates übernimmt. Dieser Sozialstaat, in Form behördlicher Strukturen, muss das Ankommen dieser Menschen in Deutschland viel intensiver begleiten. Schließlich ist unser aller Ziel die Menschen in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Nur wie ist es in der Realität: Nach der Zuweisung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – kurz BAMF – in die jeweilige Stadt oder Gemeinde, werden die flüchtenden Menschen mit Wohnraum (von Sozialwohnung bis zu Alternativlösungen in zweckentfremdeten Turnhallen) und einem finanziellen Minimum versorgt. Kaum angekommen, fällt umgehend der bürokratische Dinosaurier, in Form einer nicht enden wollenden Papierlawine, über sie her. Wir erinnern uns, das löst auch bei gestandenen Einheimischen panische Fluchtreflexe aus und die sind dabei noch der deutschen Sprache mächtig. In dieser Ausnahmesituation sollen die Menschen im fremden Land also noch den Durchblick bewahren und die Weitsicht besitzen, sich da eigenständig durchzulotsen? Natürlich brauchen die Menschen Hilfe! Denn sogar ich habe zeitweise meine Not im bürokratischen Dickicht durchzublicken. Diese Hilfe aber ist heutzutage stark von den örtlichen und überwiegend ehrenamtlichen Strukturen abhängig. In der einen Gemeinde wird diese wichtige Hilfeleistung durch breite Vereinsinitiativen geleistet, in der benachbarten Kleinstadt kannst du froh sein, wenn die Sachbearbeitenden auf dem Sozialamt auf einen Pool ehrenamtlicher Übersetzer*innen zurückgreifen können. Den sie sich über die Jahre dann auch noch aus der Not heraus selbst organisiert haben, versteht sich. Und hier wieder der berechtigte Einschub, wie stellen wir uns als Gesellschaft die Integration vor und vor allem was tun WIR dafür.

Momentan werden die wichtigen ehrenamtlichen Strukturen, ob in Form von offiziellen Vereinen, lockeren Zusammenschlüssen oder auch privaten Einzelkämpfer*innen, maßlos gefordert. Auf dem Rücken der freiwilligen Helfenden. Aus einem allgemeingesellschaftlichen Interesse für die Gemeinschaft und dem Füreinander, dass eine wichtige Bereicherung der hiesigen Integration und des Zusammenwachsens darstellen sollte, stehen wir vor einem deutschlandweiten Flickenteppich der Basisarbeit. Eine unübersichtliche Ansammlung der Hilfestellungen, die dazu noch stark von den örtlichen Initiativen und finanziellen Möglichkeiten der jeweiligen Kommunen abhängen. Es fehlt ein Fundament, dass länderübergreifend eine stabile und einheitliche Struktur schafft und damit die Arbeit der örtlichen Verwaltungen grundlegend stärkt, damit das Ehrenamt entlastet und letztendlich wertgeschätzt wird. Diese Strukturen würden gleichzeitig allen Menschen in Deutschlang helfen und dazu beitragen, die Scheu vor dem Bürokratiedino abzulegen. Was ich stattdessen sehe, sind sich überschlagende Lobgesänge auf das Ehrenamt, die Auslobung von Wettbewerben und Finanzzuschüssen für Sachausgaben und Ausrichtung von Ehrenamtsfesten. Ja das ist alles sicherlich auch wichtig, auch für die Sichtbarkeit der ehrenamtlichen Leistung und der Menschen dahinter. Für mich ist das allerdings Augenwischerei. Ich bin ein sehr engagierter Mensch und helfe viel und gerne in meinem Ort. Das Miteinander und das gemeinsame Schaffen erfüllen mich. Die Hilfe und Zeit, die ich für die ukrainischen Menschen seit März letzten Jahres aufbringe, nährt mein soziales Wohlbefinden. Und auch der Austausch mit Behörden und anderen Institutionen, wie gesagt ich bin als Übersetzerin gern gesehene Gästin, beruht auf gegenseitiger Wertschätzung. Nur wie lange ich das noch in dieser Form machen kann, weiß ich nicht. Diese Verantwortung und die Masse an offenen Punkten, die auf mir lastet, wohl bemerkt zwischen Erwerbsarbeit und Familienleben, schafft mich. Ich betreue 8 Familien. Sage und schreibe 20 Menschen, die ich im alltäglichen Leben unterstütze.
Diese kostbare Zeit verwende ich, weil eine institutionelle Not herrscht, die Menschen an die Hand zu nehmen und in unserer Gesellschaft willkommen zu heißen. Ich würde mich auch ohne diese Not engagieren, denn ein Zuviel an sozialem Zusammenleben gibt es nicht. Wertschätzung erfahre ich ohnehin direkt von den ukrainischen Menschen und den Sachbearbeitenden vor Ort. Den Ehrenamtlern und mir braucht keiner die Wichtigkeit des Engagements aufzuzeigen. In keiner Laudatio und keinem Festakt. Das dafür aufgewendete Geld und die personellen Ressourcen wären in den Ausbau der Strukturen besser investiert. Zeit und Feierlaune habe ich ohnehin nicht. Diese ist schon für wichtigeres reserviert: Fragen/Emails/Termine.